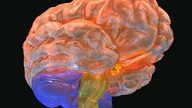Psychologie: Hospitalismus
Hospitalismus
Wenn Menschen beispielsweise in Krankenhäusern und Heimen vernachlässigt werden, können körperliche, emotionale und soziale Schäden entstehen. Dies bezeichnen Mediziner als Hospitalismus.
Von Katrin Ewert
Kindheit ohne Zuwendung und Aufmerksamkeit
Das Phänomen Hospitalismus ist selten, hat aber weitreichende Folgen – vor allem für Säuglinge und Kleinkinder. "Was ein kleines Kind am nötigsten braucht, ist die intensive und dauerhafte Gefühlsbindung zur Mutter oder einer Ersatzperson", mit diesem Satz beginnt der Dokumentarfilm "Kinder ohne Liebe" des tschechischen Kinderpsychologen Zdeněk Matějček aus den 1960er-Jahren.
Die Zuschauer sehen, wie Kinder in Krippen und Heimen zwar vom Personal versorgt und gepflegt werden, aber keinerlei Liebe, Zuwendung und Aufmerksamkeit bekommen. Babys liegen in Gitterbetten, die sich – jeweils mit reichlich Abstand – in einem Raum aneinanderreihen.
Die Kleinen verbringen die Tage ohne Spielzeuge, Berührungen, Kontakte und jegliche Reize um sie herum. Höchstens für einen kurzen Moment schaut eine Pflegerin in eins der Betten und spricht mit dem Säugling.
Forscher Matějček zeigt in dem mehrfach ausgezeichneten Film eindrücklich, was mit Kindern passiert, die ohne körperliche und emotionale Nähe aufwachsen. Die Kleinen zeigen körperliche und geistige Defizite, sind ängstlich und abwesend.
Matějček machte damit auf ein bis dahin zwar bekanntes, aber wenig beachtetes Phänomen aufmerksam: den Hospitalismus. Forscher beschreiben mit diesem Begriff die Schäden durch körperliche, emotionale und soziale Vernachlässigung.
Die Folgen sind gravierend. Im Film können die Zuschauer zwei Kinder beobachten, die jeweils ihren ersten Geburtstag feiern und einen Teddybären geschenkt bekommen – ein Spielzeug, das beide Kinder vorher noch nicht kannten.
Das erste Kind wächst innerhalb seiner Familie mit Liebe und Geborgenheit auf. Als dieses Kind den Teddybären erblickt, greift es neugierig danach, lacht und quietscht vor Vergnügen im Arm seiner Mutter. Anders als das zweite Kind, das im Heim aufwächst. Es erschrickt beim Anblick des Teddybären, schaut ängstlich und fängt an zu weinen.
Matějček zufolge hat das Familien-Kind durch die Fürsorge seiner Eltern Mut, Vertrauen und Sicherheit entwickelt und reagiert deshalb mit Neugier auf die neue Situation. Genau diese Eigenschaften fehlen jedoch dem Heim-Kind, das von seinen Eltern und damit einer festen Bezugsperson getrennt wurde und nicht genügend Zuwendung bekam. Das Kind reagiert ängstlich und verunsichert.
Für die Entwicklung eines Kindes ist es anscheinend sehr wichtig, dass es mindestens eine Bezugsperson gibt, die dem Kind liebevolle Zuwendung und körperliche Nähe spendet und eine emotionale Bindung zu ihm herstellt.

Kindern mit Hospitalismus fehlt eine feste Bezugsperson
Ernstzunehmende Auswirkungen
Hospitalismus hat schwerwiegende Folgen für das betroffene Kind. Mediziner unterscheiden zwischen seelischen und körperlichen Schäden (psychischen und physischen).
Die psychischen Auswirkungen bezeichnen Ärzte auch als Deprivationssyndrom, was den Mangel oder Entzug von etwas Notwendigem meint. Die Kinder leiden im Vergleich zu Gleichaltrigen unter Entwicklungsverzögerungen und -störungen. Sie haben zum Beispiel Probleme damit, Beziehungen und Gefühle zu anderen Menschen aufzubauen. Außerdem können folgende Symptome auftreten:
- Passivität
- Antriebslosigkeit
- Depressionen
- Ängstlichkeit
- Unsicherheit
- Abwesenheit, Teilnahmelosigkeit
- fehlende Gestik und Mimik
- mangelnde Empathiefähigkeit
- geringes Selbstwertgefühl
- Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten
- hohes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit
- Reizbarkeit
Eine typische körperliche Folge von Hospitalismus sind sogenannte stereotype Bewegungen. Betroffene Kinder wippen und schaukeln ihren Oberkörper ohne Anlass hin und her. Auch Daumenlutschen und Bettnässen sind typische Verhaltensmuster.
Einige Heranwachsende leiden unter körperlichen Entwicklungsstörungen. Sie lernen deutlich später als Gleichaltrige zu laufen und zu sprechen. Viele haben einen schlechten allgemeinen Gesundheitszustand und sind anfälliger für Krankheiten.
Studien konnten außerdem zeigen, dass sich das Gehirn bei Kindern mit Hospitalismus anders entwickelt. So stellten US-amerikanische Wissenschaftler im Jahr 2013 fest, dass Kinder, die ihre ersten Lebensjahre in Heimen in Rumänien verbrachten, eine dünnere Hirnrinde besitzen und einige elektrische Signale im Gehirn nicht voll funktionsfähig sind. Britische Forscher konnten 2020 nachweisen, dass das Gehirn von Menschen umso kleiner ist, je länger sie als Kinder vernachlässigt wurden.

Entwicklungsstörungen, Depressionen und Ängste sind häufige Symptome von Hospitalismus
Neben den psychischen und physischen Folgen gibt es auch noch das sogenannte Kaspar-Hauser-Syndrom – die schwerste Form von Hospitalismus. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus völliger Isolation und Misshandlung.
Namensgeber dieser Form von Hospitalismus ist Kaspar Hauser: ein Findelkind, das im 19. Jahrhundert als 16-Jähriger in Nürnberg auftauchte. Er war seine komplette Kindheit und Jugend in einem dunklen Raum festgehalten worden und hatte lediglich Wasser und Brot bekommen.
Kaspar Hauser hatte einen beschränkten Wortschatz und sprach sehr wenig. Er kam bei einem Lehrer unter, der ihm Lesen und Schreiben beibrachte. Einige Jahre später starb er an einer Stichwunde. Es ist umstritten, ob es sich dabei um ein Attentat handelte oder ob sich der Junge selbst verletzt hatte.
Kinder, die ähnlich wie Kaspar Hauser in starker Reizarmut und menschenunwürdigen Verhältnissen aufwachsen, dazu noch emotional oder körperlich misshandelt werden, sind oftmals körperlich und geistig unterentwickelt und leiden unter extremer Ängstlichkeit.

Nach Kaspar Hauser wurde die schwerste Hospitalismus-Form benannt
Nicht nur Kinder sind betroffen
Grundsätzlich ist Hospitalismus heute ein eher seltenes Phänomen. Es trat vor allem in den 1950er- bis 1970er-Jahren in Kinderheimen und -krippen von sozialistisch geprägten Staaten wie etwa in der Tschechoslowakei und Rumänien auf. In diesen Ländern arbeiteten häufig sowohl die Väter als auch die Mütter ganztags.
Dem Dokumentarfilm des tschechischen Forscher Matějček zufolge übernahmen staatliche Stellen die Baby- und Kinderpflege; ein Mitarbeiter betreute in Krippen oftmals mehrere Dutzend Heranwachsende gleichzeitig, wie der Dokumentarfilm anschaulich zeigt. In Kinder- und Waisenheimen sah die Situation oft ähnlich aus.
Der Wiener Psychoanalytiker René Spitz stellte fest, dass insbesondere Personen unter Hospitalismus-Folgen leiden, die bereits als Säuglinge und Kleinkinder in Heimen lebten. Besonders kritisch sei der Zeitraum zwischen dem sechsten und zehnten Lebensmonat. In diesem Zeitraum festigt sich laut Spitz normalerweise die Mutter-Kind-Beziehung.

Nähe und Zärtlichkeit sind nicht nur für Babys lebenswichtig
Doch nicht nur in Heimen und Krippen kann Hospitalismus entstehen. Es können auch Kinder darunter leiden, die zwar zu Hause aufwachsen, aber nur wenig Aufmerksamkeit und Zuwendung von den Eltern spüren. Untersuchungen zeigen, dass vermehrt Kinder betroffen sind, die aus zerrütteten Familienverhältnissen kommen oder deren Eltern alkohol- bzw. drogenabhängig sind.
Auch Erwachsene können unter Hospitalismus leiden. Forscher konnten ähnliche Effekte bei Menschen beobachten, die über längere Zeit in einem Krankenhaus behandelt wurden und während dieser Zeit nicht ausreichend Zuwendung erhielten. Sie neigten zu Depressionen, Ängstlichkeit und Reizbarkeit. Auch in Gefängnissen kommt Hospitalismus vor – insbesondere bei Isolationshaft ohne Kontakt zur Außenwelt.
In Alten- und Pflegeheimen kann Hospitalismus auftreten, wenn die Bewohner durch Personalmangel oder unzureichende Pflege oft allein gelassen werden. Betroffene Senioren wiegen sich in ihrem Stuhl oder Bett hin und her und bauen schneller geistig und körperlich ab.

Auch einige ältere Menschen in Pflegeheimen leiden unter Hospitalismus
Meist Psychotherapie notwendig
Gegen Hospitalismus-Symptome hilft vor allem eins: Die betroffene Person so früh wie möglich aus der schädigenden Umgebung herausnehmen und ihr besonders viel Zuwendung, Fürsorge und Aufmerksamkeit schenken. Untersuchungen zeigen: Je früher ein Heimkind in eine liebevolle Umgebung kommt, desto höher ist die Chance, dass sich Erscheinungen wie Ängstlichkeit und Entwicklungsstörungen wieder zurückbilden.
Das konnten auch neurologische Studien belegen. Die US-amerikanischen Forscher, die Heimkinder in Rumänien untersuchten, stellten fest, dass sich das Gehirn unter bestimmten Umständen wieder erholen kann.
Bei Kindern, die spätestens als Zweijährige zu einer Pflegefamilie kamen, glich das Gehirn seine Defizite wieder aus. Ein Team aus britischen und deutschen Forschern untersuchte Kinder, die maximal sechs Monate im Heim verbracht hatten. Die Kleinen waren psychisch genauso gesund wie Gleichaltrige, die bei ihren Eltern aufgewachsen waren.
Je länger ein Kind jedoch vernachlässigt wird, desto schwerer und hartnäckiger sind die Folgen von Hospitalismus. Oft ist eine Psychotherapie notwendig, in denen die Betroffenen lernen, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und sich in sozialen Gruppen zurechtzufinden. Oft müssen sie auch an ihren Angststörungen und Depressionen arbeiten. In manchen Fällen sind die Hospitalismus-Folgen jedoch so schwer, dass sie bis ins Erwachsenenalter oder für immer bestehen bleiben.

Gegen die Folgen von Hospitalismus hilft viel Zuwendung – und eine Psychotherapie
Wie sich Hospitalismus vorbeugen lässt
Dank der Forschung und dem vermehrten Wissen darüber, welche Bedürfnisse Säuglinge und Kleinkinder haben, tritt Hospitalismus heute nur noch sehr selten auf. Heime, Krippen und Kliniken sind heute kindgerechter gestaltet. Mehrere Pflegekräfte und Erzieher kümmern sich um eine kleine Gruppe von Kindern.
Eltern und weitere Bezugspersonen werden dazu ermutigt, die Kinder regelmäßig zu besuchen. In Krankenhäusern können Eltern zusammen mit dem Kind in einem Zimmer aufgenommen werden (sogenanntes Rooming-In). Heimkinder finden heute in der Regel deutlich schneller eine Pflegefamilie.
Sozialarbeiter und -pädagogen werden miteinbezogen, um Hospitalismus und deren Folgen vorzubeugen. Das gilt nicht nur für Heime, sondern auch für Familien zu Hause. Es gibt beispielsweise mobile Erziehungshilfen und Notmütterdienste, die die Eltern entlasten und sicherstellen, dass Kinder in einer liebevollen Umgebung aufwachsen.
Und auch für Senioren und Menschen mit Behinderung, die auf eine Langzeitpflege angewiesen sind, haben sich die Umstände in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert. Diese Institutionen sind heute so eingerichtet, dass sie an ein wohnlich gestaltetes Zuhause und nicht an ein Krankenhaus erinnern. Der Alltag in Pflegeheimen wird durch Spiel- und Gesprächsrunden aufgelockert.
Zusätzlich sind neue Wohnformen wie etwa Betreutes Wohnen oder Pflege-WGs entstanden, in denen den Bewohnern viel Kontakt und Beschäftigung ermöglicht wird.

Heute sind Heime kindgerechter gestaltet
Hospitalismus bei Tieren
Hospitalismus kommt auch in der Tierwelt vor. Der US-amerikanische Verhaltensforscher Harry Harlow untersuchte in einem Experiment Rhesusaffen, die ohne Mutter aufwuchsen. Als Futter stellte er den Äffchen zwei Optionen zur Wahl: Zwei Drahtgestelle mit einer Milchflasche, eins davon mit einem weichen Stoff überzogen.
Die Tiere wählten stets die Plüsch-Attrappe und klammerten sich während des Trinkens daran fest. Das zeigte, dass die jungen Affen neben dem Bedürfnis nach Nahrung auch ein Grundbedürfnis nach Nähe haben.
In einem anderen Experiment wuchsen Rhesusaffen vollständig isoliert auf. Die Tiere zeigten starke Verhaltensauffälligkeiten wie Teilnahmslosigkeit und Aggressionen und waren nicht dazu fähig, eigenen Nachwuchs aufzuziehen.
Auch Haus- und Nutztiere können Hospitalismus-Erscheinungen entwickeln. Isolierte Küken setzen sich in eine Ecke des Käfigs und starren die Wand an. Pferde, die über lange Zeit in Ställen eingesperrt sind, wiegen sich hin und her. Bei Eisbären, die in Zoos in Gefangenschaft leben, konnten Forscher ähnliche Verhaltensmuster beschreiben: Sie bewegen ihren Kopf nach links und rechts.
UNSERE QUELLEN
- Universität Hamburg: Hospitalismus.
- Stangl Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik: Hospitalismus, 2021.
- Spektrum Lexikon der Psychologie: Hospitalismus.
- Medizin-Lexikon Doccheck: Hospitalismus, 2017.
- Köther, Ilka: Psychischer Hospitalismus. In: Köther, Ilka (Hrsg.): Altenpflege. Thieme, 2016.
- Fox, Nathan et al.: The Effects of Early Severe Psychosocial Deprivation on Children's Cognitive and Social Development: Lessons from the Bucharest Early Intervention Project. In: Landale, Nancy et al. (Hrsg.): Families and Child Health. Springer, 2013.
- Mackes, Nuria K., et al.: Early childhood deprivation is associated with alterations in adult brain structure despite subsequent environmental enrichment. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020.
- Golm, Dennis et al.: The impact of childhood deprivation on adult neuropsychological functioning is associated with ADHD symptom persistence. Psychological Medicine, 2020.
- McLaughlin, Katie et al.: Childhood adversity and neural development: deprivation and threat as distinct dimensions of early experience. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2014.
- Stary, Ute: Wochenkrippen und Kinderwochenheime in der DDR. Bundeszentrale für politische Bildung, 19.01.2018.
(Erstveröffentlichung 2021. Letzte Aktualisierung 09.06.2021)
Quelle: WDR